Inhalt

Wissenschaftlich geprüft von:
Pia Glatte-Bast
Inhalt

Wissenschaftlich geprüft von:
Pia Glatte-Bast
Was ist die bakterielle Infektion der Scheide?
Eine Vaginose ist eine bakterielle Infektion der Scheide, in der Regel mit dem Bakterienstamm Gardnerella vaginalis. Auch wenn diese im Vergleich zu Scheidenpilz oder Blasenentzündung zu den weniger bekannten vaginalen Infektionskrankheiten zählt, trifft sie doch etwa jede fünfte Frau mindestens einmal in ihrem Leben – und in 80 % dieser Fälle gleich mehrfach. Ein nicht zu verachtendes Problem der Frauengesundheit.

Was sind die Symptome einer bakteriellen Vaginose?
Da sich die Symptome der bakteriellen Vaginose häufig denen anderer Erkrankungen im Intimbereich ähneln, ist eine ärztliche Abklärung unerlässlich, um eine sichere Diagnose zu treffen. Dazu verläuft etwa jede zweite Infektion ohne erkennbare Symptome. Wenn Symptome auftreten, zeigen sich vor allem folgende Anzeichen:
-
Ungewöhnlicher Ausfluss: Veränderungen in der Menge, Farbe und Konsistenz des Ausflusses können auf eine Infektion hindeuten. Bei einer Vaginose ist dieser üblicherweise dünnflüssig, grau-weißlich und tritt in größeren Mengen als üblich auf.
-
Unangenehmer Geruch: Besonders charakteristisch ist ein unangenehmer, an Fisch erinnernder Geruch, dessen Intensität nach dem Geschlechtsverkehr oder während der Periode oft noch zunimmt.
-
Leichtes Brennen oder Jucken: Ein Brennen oder Jucken, manchmal auch begleitet von einer Rötung oder Schwellung, ist ein weiteres lästiges Symptom.
-
Veränderter pH-Wert: Normalerweise weist die Vagina einen sauren pH-Wert zwischen 3,8 und 4,4 auf. Bei einer bakteriellen Vaginose ist dieser oftmals leicht erhöht und liegt über 4,5.
- Psychische Belastung: Neben den körperlichen Beschwerden ist eine Infektion des Vaginalbereichs für Frauen oft auch mit einer seelischen Belastung verbunden. Zum einen durch die unangenehmen Symptome selbst, zum anderen auch durch Schamgefühle oder die Beeinträchtigung des Liebeslebens. So geben in einer Umfrage fast drei Viertel der Frauen, die mit einer wiederkehrenden bakteriellen Vaginose zu kämpfen haben, an, dass diese ihre mentale Gesundheit negativ beeinflusse.

Was sind Ursachen und Risikofaktoren für bakterielle Vaginose?
Antibiotika sind bislang die Standardtherapie bei einer Vaginose und beseitigen Erreger in der Regel zuverlässig. Gleichzeitig können sie aber auch die nützlichen Milchsäurebakterien der Scheidenflora beeinträchtigen, was das Risiko für erneute Infektionen signifikant erhöht. Hierauf gehen wir etwas später im Detail ein. Neben Antibiotika gibt es aber auch einige andere Faktoren, die ein Ungleichgewicht der Intimflora begünstigen und somit den Weg für eine Infektion ebnen können. Hierzu zählen:
-
Hormonelle Veränderungen: Ein nicht zu unterschätzender Faktor, da Frauen jeder Altersgruppe betroffen sein können. Seien es hormonelle Schwankungen während der Menstruation, der Schwangerschaft oder der Menopause: Ein unregelmäßiger Östrogenspiegel kann die Vaginalflora auf ungünstige Weise beeinflussen. In den Wechseljahren kommt es außerdem zu einem Östrogenmangel. Gleichsam wird die Scheidenwand dünner und der pH-Wert verändert sich.
-
Sexuelle Aktivität: Wer häufig seine Sexualpartner wechselt und dabei unter Umständen sogar ungeschützten Geschlechtsverkehr hat, ist einem deutlich höheren Risiko ausgesetzt, fremde Bakterien in den Intimbereich aufzunehmen. Dennoch ist eine bakterielle Vaginose jedoch keine klassische sexuell übertragbare Krankheit.
-
Falsche Intimhygiene: Körperpflege ist natürlich wichtig, aber nicht immer richtig. Denn genauso wie es ein Zuwenig gibt, gibt es auch ein Zuviel. Insbesondere der pH-Wert des Intimbereichs unterscheidet sich deutlich von dem des restlichen Körpers. Intimsprays, Vaginalduschen oder unpassende Seifen können ihn verändern und so das Milieu der Bakterien beeinträchtigen.
-
Verwendung von intrauterinen Verhütungsmitteln (IUP): Untersuchungen zeigen, dass die Verwendung der Spirale diverse Infektionen des Intimbereichs begünstigen kann. Zwar verringert sich die Zahl der schützenden Lactobazillus-Arten nicht erheblich, dafür nimmt die Besiedelung mit Erregern wie Gardnerella vaginalis oder Atopobium vaginae signifikant zu.
- Rauchen: Rauchen gilt allgemein als gesundheitsschädigend und kann sämtliche Mikrobiome des Körpers in eine Dysbiose stürzen – so auch das Vaginalmikrobiom.
Behandlung einer bakteriellen Vaginose mit Antibiotika
Glücklicherweise lässt sich eine bakterielle Infektion der Scheide recht einfach behandeln. Doch leider hat diese Effektivität auch eine Kehrseite.
Gängig ist die Bekämpfung mit Antibiotika. Sie dezimieren die Erreger schnell und gründlich. Das Problem ist, dass gerade Antibiotika einen großen Teil dazu beitragen, dass 80 Prozent der Frauen nach kurzer Zeit einen Rückfall haben.
Das erklärt sich folgendermaßen: Antibiotika unterscheiden nicht zwischen krankmachenden Bakterien und solchen, die wünschenswert sind. Letztere spielen jedoch entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Vaginalgesundheit. Dieses Ökosystem wird auch als vaginales Mikrobiom bezeichnet. Es handelt sich um eine vielfältige Gemeinschaft aus Bakterien, Pilzen und anderen Mikroben, die in einem empfindlichen Gleichgewicht zueinanderstehen.
Das Vaginalmikrobiom ist bei jeder Frau einzigartig zusammengesetzt. Typischerweise dominieren jedoch Milchsäure-produzierende Bakterien, insbesondere verschiedene Stämme der Gattung Lactobacillus. Diese Bakterien sorgen durch die Produktion von Milchsäure für ein leicht saures Scheidenmilieu mit einem pH-Wert zwischen 3,8 und 4,4. Dadurch wird das Wachstum schädlicher Keime gehemmt. Jeder Bakterienstamm innerhalb des Vaginalmikrobioms übernimmt dabei spezifische Aufgaben, etwa den Schutz vor Infektionen, die Stabilisierung des pH-Werts oder die Unterstützung des Immunsystems.
Während einer Antibiotika-Behandlung werden nun zum Beispiel bestimmte Bakterienstämme zurückgedrängt, wodurch andere Stämme überhandnehmen können. Ein anderes Szenario ist, dass die Gesamtbesiedelung gehemmt wird, wodurch insgesamt zu wenig Bakterien vorhanden sind, um die anstehenden Aufgaben – die Bekämpfung von Keimen – zu erledigen.
Ein solches Ungleichgewicht wird auch Dysbiose genannt und gilt in der aktuellen Forschung als das Einfallstor schlechthin für wiederkehrende Infektionen. Eine Antibiotika-Behandlung bedeutet dementsprechend einen „Kahlschlag“, der das Scheidenmikrobiom schwächt und anfällig für neue Keime macht – ein Teufelskreis.
Wie kann man einer bakteriellen Vaginose vorbeugen?
Der Schutz der natürlichen Vaginalflora ist das A und O, wenn es darum geht, einer bakteriellen Vaginose vorzubeugen. Nachfolgend einige Hinweise, die Sie beachten sollten:
-
Intimhygiene mit Maß: Zu häufiges Waschen des Intimbereichs mit ungeeigneten Pflegeprodukten kann das Vaginalmikrobiom stören. Klares Wasser und bei Bedarf ein Reinigungsgel, das auf den nötigen pH-Wert abgestimmt ist, ist völlig ausreichend.
-
Gesunde Lebensweise: Verzichten Sie weitgehend auf ungesunde Gewohnheiten wie Rauchen und übermäßigen Alkoholgenuss. Machen Sie sich stattdessen eine gesunde und vitaminreiche Ernährung zu eigen, die gleichzeitig auch das Immunsystem stärkt.
-
Kleidung: Atmungsaktive Unterwäsche aus Baumwolle vermindert das Risiko, dass ein zu feuchtes Milieu entsteht, in dem sich Bakterien vermehren können.
-
Sexualhygiene: Kondome bieten den besten Schutz gegenüber sexuell übertragbaren Krankheiten, aber auch bakteriellen Infektionen.
- Gezielte Unterstützung der Vaginalflora: Durch die Zufuhr spezifischer Mikrokulturenpräparate (im Volksmund häufig auch als Probiotika bezeichnet), können der Vaginalflora wieder wichtige Bakterienstämme zugeführt werden, die sie beispielsweise nach einer Antibiotikabehandlung verloren hat.

Neuer Forschungsansatz greift die Wichtigkeit der Intimflora auf
Noch recht neuartig und daher weitgehend unbekannt ist der letztgenannte Ansatz, die Vaginalflora gezielt durch die Zufuhr oral eingenommener Mikrokulturenpräparate zu unterstützen. Besonders die Milchsäure-produzierenden Laktobazillen spielen bei diesem Ansatz eine entscheidende Rolle: Denn wie erwähnt halten sie den pH-Wert der Scheide im säuerlichen Bereich und machen es dadurch schädlichen Keimen schwer.
Eine gesunde und vielfältige Zusammensetzung der Scheidenflora ist daher essenziell für den Schutz vor Infektionen. Genau dieses Wissen macht sich diese Präventionsmethode der Unterstützung der Vaginalflora zunutze. Nur wie? Es bedarf einer gezielten Einbringung spezifischer Bakterien in dieses Milieu. Aber wodurch lässt sich das bewerkstelligen?
Die Antwort darauf greift einen Ansatz auf, der bereits im Bereich der Darmgesundheit mittels sogenannter Probiotika seit geraumer Zeit verfolgt wird. Denn das dort sitzende Darmmikrobiom ist ein zentraler Knotenpunkt unseres Wohlbefindens, da es nicht nur für den Darm, sondern auch für das Immunsystem und sogar den ganzen Körper von größter Bedeutung ist, wie in einer unüberschaubaren Zahl an Studien belegt wurde. So haben die Bakterien im Darm Einfluss auf die Hautgesundheit, auf Gewichtsprobleme und sogar auf unsere Psyche.
Während Mikrokulturenpräparate gewöhnlicherweise oral zugeführt werden und direkt dort landen, wo sie benötigt werden – also im Darm –, ist dieser Weg für Präparate speziell für das Vaginalmikrobiom nicht geeignet, könnte man meinen. Die gute Nachricht: Tatsächlich konnten mehrere Studien nachweisen, dass sich bestimmte Laktobazillen nach oraler Einnahme auch im vaginalen Mikrobiom in größerer Menge ansiedeln.
Ein Versuch etwa zeigte, dass Frauen mit vaginalen Infektionen, denen ein Präparat mit Lactobacillus plantarum verabreicht wurde, zum einen eine erhöhte Besiedelung mit diesem Bakterienstamm nachzuweisen war, zum anderen aber auch eine Verbesserung ihrer Symptome. Beobachtungen wie diese unterstreichen das unglaubliche Potenzial, das Mikrokulturenpräparaten innewohnt.
Das Problem ist, dass nicht einfach irgendwelche Mikrokulturen verzehrt werden können, um das Vaginalmikrobiom zu unterstützen. Es dauerte Jahre, bis Wissenschaftler vier Bakterienstämme identifiziert hatten, die für eine gesunde Scheidenflora besonders wichtig sind:
- Lactobacillus gasseri: Die Bakterien der gasseri-Familie sind besonders effektiv dabei, Milchsäure zu produzieren und für ein saures Milieu im Kampf gegen pathogene Keime zu sorgen.
- Lactobacillus crispatus: Sie produzieren große Mengen an Wasserstoffperoxid (H2O2), welches ebenfalls antimikrobiell wirkt und so das Wachstum schädlicher Keime hemmt.
- Lactobacillus delbrueckii: Bakterien dieser Familie zeigten in Studien ein großes Potenzial, das Gleichgewicht der Scheidenflora wiederherzustellen sowie vor Pilzinfektionen zu schützen.
- Lactobacillus plantarum: Auch diese Bakterienfamilie hat in Studien eine positive Wirkung bei Pilzinfektionen gezeigt.

Sie haben Fragen?
Dieser Service ist für Sie kostenlos.
Oder direkt kontaktieren via
E-Mail: info@kijimea.de
Telefon: +49 897 879 790 3007
Montag bis Donnerstag:
8:00 bis 16:00 Uhr
Freitag: 8:00 bis 15:00 Uhr
Kijimea FloraCare
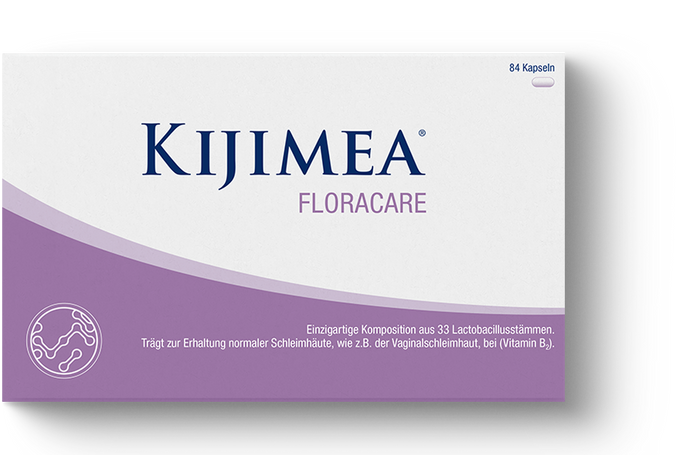
Exkurs: Kann eine bakterielle Vaginose während der Schwangerschaft zu Komplikationen führen?
Auch wenn eine bakterielle Vaginose in aller Regel eher selten zu ernsthaften Problemen führt, sollten vor allem Frauen mit Kinderwunsch gewisse Risiken kennen, die mit einer Infektion verbunden sind. Unbehandelt kann sie während der Schwangerschaft zu folgenden Komplikationen führen:
- Frühgeburt
- Vorzeitiger Blasensprung
- Niedriges Geburtsgewicht (oft unter 2.500 Gramm)
- Infektionen der Gebärmutter nach der Geburt
Fazit
Die bakterielle Vaginose ist eine Infektion der Scheide, in der Regel mit Gardnerella-vaginalis-Bakterien. Sie ist zwar in den meisten Fällen harmlos, kann Betroffene jedoch durch ihre Symptome und das hohe Rückfallrisiko erheblich belasten.
Klassische Behandlungen mit Antibiotika sind effektiv, greifen jedoch häufig das empfindliche Gleichgewicht der Scheidenflora an und begünstigen so eine erneute Infektion. Deshalb wird zunehmend die Bedeutung einer intakten Vaginalflora betont – nicht nur zur Behandlung, sondern vor allem zur Vorbeugung.
Eine gesunde Lebensweise, eine speziell an die Bedürfnisse der Scheide angepasste Intimhygiene und eine gezielte Unterstützung durch geeignete Mikrokulturenpräparate können helfen, das Gleichgewicht im Intimbereich zu stabilisieren.
Insbesondere neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu nützlichen Laktobazillen eröffnen hier vielversprechende Perspektiven für eine nachhaltige Frauengesundheit.
Häufig gestellte Fragen
Wie heißt die bakterielle Infektion der Scheide?
Ist bakterielle Vaginose dasselbe wie Scheidenpilz?
Was ist der ideale pH-Wert des Scheidenmilieus?
Kann eine bakterielle Scheideninfektion Schmerzen beim Geschlechtsverkehr verursachen?
Quellen:
Disclaimer
Die Informationen auf dieser Seite stellen keine medizinische Beratung dar und sollten nicht als solche betrachtet werden. Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie Ihre regelmäßige medizinische Versorgung ändern.

